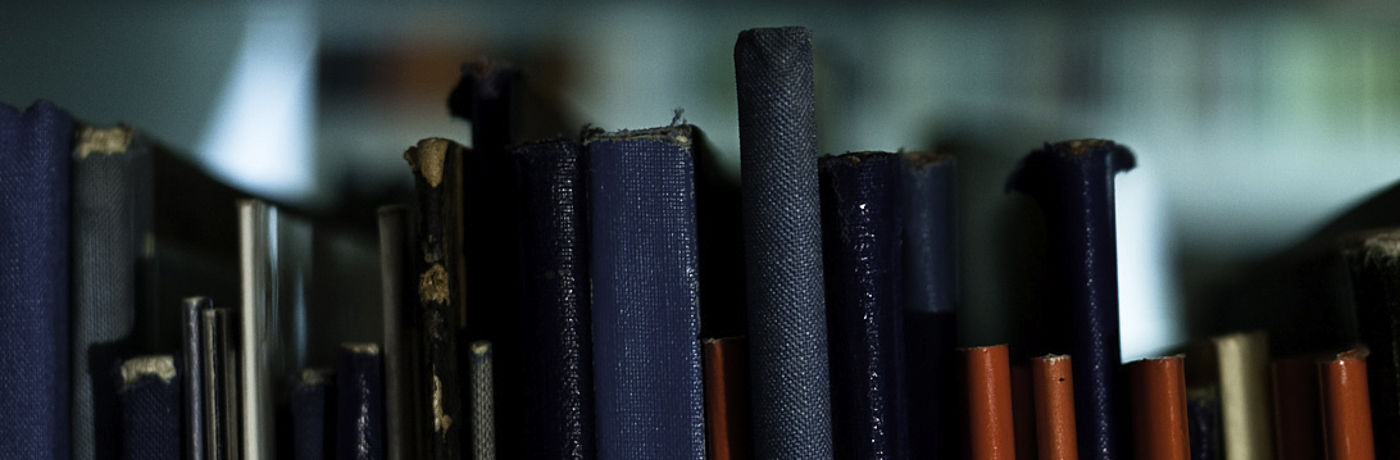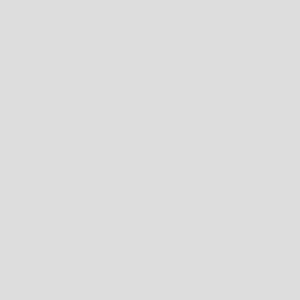Institut für Musikwissenschaft IMW
Alte und neue Musik, historische und systematische Ansätze: Das Institut für Musikwissenschaft versucht eine Vermittlung. Die Resonanz „alter“ Musik in der Gegenwart zu zeigen, die Bezüge zur Tradition in der zeitgenössischen Musik zu erhellen, ist das Ziel.
Forschung
Arbeiten zur älteren sächsischen Musikgeschichte stehen neben wissenschaftlichen Gesamtausgaben, darunter das große Projekt einer Edition aller Korrespondenzen von Clara und Robert Schumann. Studien zu Carl Maria von Weber, Richard Wagner, Richard Strauss, György Ligeti entstehen in Begleitung von Produktionen der Semperoper und der Dresdner Philharmonie. Die klassische Moderne wie die Musikgeschichte Mittelosteuropas bilden weitere Themenschwerpunkte, die von Projekten zu Klang und Struktur, Semiotik und Ästhetik flankiert werden.
In enger Verbindung zum Institut für Neue Musik und der musikalischen Praxis werden innovative methodische Ansätze erkundet und in zahlreichen Studien – im Institut für Musikwissenschaft entstehen derzeit mehr als 30 Dissertationen – vertieft: Resultate auch der Verbindungen zu etlichen Akademien, Hochschulen, Forschungsinstituten und Archiven weltweit.
Heinrich Schütz-Archiv
1985 von Wolfram Steude begründet, hat sich das Heinrich-Schütz-Archiv zum Zentrum der Forschung mitteldeutscher Musik des 17. Jahrhunderts entwickelt. Hier wird an drei großen Gesamtausgaben gearbeitet: von Heinrich Schütz, Andreas Hammerschmidt und Johann Rosenmüller. Systematisch werden die Quellen von deren Werken gesammelt. Nicht im Original, sondern mit Digitalisaten aller erhaltenen Handschriften und Drucke weltweit, ergänzt um Scans des Sächsischen Hauptstaatsarchivs Dresden, der Sächsischen Landesbibliothek sowie zahlreicher weiterer Archive in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Die Notenausgaben flankieren die „Schütz-Dokumente“, in deren Zeugnisse zu Leben und Werk von Schütz und seinen Zeitgenossen, zudem von Lebens- und Arbeitsbedingungen musikalischer Ensembles im 17. Jahrhundert vorgelegt werden. Rezeptionsgeschichtliche Studien ergänzen die philologische Arbeit.
Zudem wird mit dem „Mitteldeutschen Kantatenarchiv“ die Breite der Kirchenmusik in Kursachsen dokumentiert und mit Erstausgaben erschlossen. (Aufführungsmaterial steht leihweise zur Verfügung.)
Die Bestände des Heinrich-Schütz-Archivs sind öffentlich zugänglich, jedoch nur vor Ort nutzbar.
Gesamtausgabe der Werke Heinrich Schütz‘ (Stuttgarter Schütz-Ausgabe)
Mitteldeutsches Kantatenarchiv
Lehre
Lehre und Forschung des Instituts erstrecken sich über den gesamten Bereich der Historischen Musikwissenschaft, von Alter Musik bis zur Gegenwart. Das Fach Musikwissenschaft ist Bestandteil der künstlerischen, musikpädagogischen und der Lehramtsstudiengänge in Bachelor und Master. Es kann außerdem als Aufbaustudiengang mit dem abschliessender Promotion studiert werden. Eine Habilitation im Fach Musikwissenschaft ist ebenfalls möglich
Wintersemester
-
Jazz/Rock/Pop-Geschichte (Seminar)|Seminar Musikwissenschaft: Ragtime zwischen oral tradtion und Komposition
Mo, 14:30 - 16:00Modul-CodesJRP T3 (BA MU), TuH (MA MU), TuH-JRP (MA MU), TuH 4, BP – OP (MA MUw)
RaumW 4.11
DozentMarius Moritz
ZeitenMo, 14:30 - 16:00 Uhr
SemesterWS
KommentarAnmeldung beim Dozenten: marius.moritz@mailbox.hfmdd.de
Das Seminar untersucht Entstehung und Entwicklung des wichtigsten Vorläufers des amerikanischen Jazz, v.a. im Hinblick auf Innovationsgehalt und gesellschaftliche Bedeutung. Wichtiger Bestandteil wird v.a. die Beleuchtung des Spannungsfeld zwischen komponierter Klaviermusik und (teil)improvisierter Bandmusik anhand von Interviews und Aufnahmen der Library of Congress sein.
Weitere Quellen: Lomax, Alan, Mister Jelly Roll Harer, Ingeborg: Ragtime, Versuch einer Typologie King of Ragtime: Berlin, Edward A.Pflicht fürBachelor JRP Akustische Gitarre
Bachelor JRP Gesang
Bachelor JRP IGP Akustische Gitarre
Bachelor JRP IGP Gesang
Bachelor JRP IGP Instrumental
Bachelor JRP InstrumentalFachsemester6
-
Seminar Musikwissenschaft: '„Über Bergs Wozzeck zwischen den zeitlichen Signaturen des „Abgrundes“ und der „Ewigkeit“ <br>100. Jahre nach der Uraufführung“ '
Modul-CodesTuH (MA MU), TuH-JRP (MA MU), TuH 4, BP – OP (MA MUw)
RaumP 4.09 (Wettiner Platz 10)
DozentProf. Marc Andre
ZeitenSemesterWS
KommentarTermine:
-29.09.25: 14:00-20:30, Bibliothek des IMW
-30.09.25: 09:00-14:00, Bibliothek des IMW
-06.10.25, 13:00-19:30, Bibliothek des IMW
-20.10.25, 13:00-19:30, Bibliothek des IMW
Über Bergs Wozzeck zwischen den zeitlichen Signaturen des „Abgrundes“ und der „Ewigkeit“ 100. Jahre nach der Uraufführung“ :Es geht ums Nachdenken über die verschiedenen Zeit-Signaturen als Kern des kompositorischen Ansatz Bergs in diesem Werk.
Bitte eine Partiutur der Oper vorbereiten. -
Seminar Musikwissenschaft: Der Liederzyklus im 19. Jahrhundert: Entstehung, Analyse, Rezeption und Inszenierung
Do, 10:00 - 11:30Modul-CodesTuH (MA MU), TuH-JRP (MA MU), TuH 4, BP – OP (MA MUw)
RaumP 4.09 (Wettiner Platz 10)
DozentJelena Mrotzek
ZeitenDo, 10:00 - 11:30 Uhr
SemesterWS
KommentarDie Aufführung eines ganzen Liederzyklus als abendfüllendes Programm ist schon längst eine Selbstverständlichkeit, doch entstanden viele der großen Zyklen lange bevor sie erstmals vollständig der Öffentlichkeit vorgetragen – oder besser: zugemutet – werden konnten. Dieses Seminar thematisiert die Entstehung, Rezeption und Aufführungspraxis dieser Gattung, analysiert die textlich-musikalischen Motive, das Klangmalerische im Klavierpart und die Dramaturgie. Auch Fragen nach den Beiträgen von Komponistinnen und zu heutigen Inszenierungen rücken in den Fokus.
Um Vorab-Anmeldung mit Angabe des jeweiligen Studiengangs wird über Herrn Dr. Mende gebeten (formlos an wolfgang.mende@mailbox.hfmdd.de).
Beginn: 09.10.25 -
Seminar Musikwissenschaft: Musiktheaterwerke seit 1990
Fr, 09:30 - 14:30Modul-CodesTuH (MA MU), TuH-JRP (MA MU), TuH 4, BP – OP (MA MUw)
RaumP 4.09 (Wettiner Platz 10)
DozentProf. Dr. phil. habil. Jörn Peter Hiekel
ZeitenFr, 09:30 - 14:30 Uhr
SemesterWS
KommentarZu den faszinierendsten und lebendigsten Bereichen der Gegenwartsmusik gehört ohne Zweifel der Bereich des Musiktheaters. Gibt es darin doch ein breites Spektrum von Ansätzen, die es zu erkunden gilt. Das versucht das Seminar zu leisten, indem es u.a. Werke von Hans Abrahamsen, Mark Andre, Georges Aperghis, Beat Furrer, Georg Friedrich Haas, Hans Werner Henze, Toshio Hosokawa, Helmut Lachenmann, Isabel Mundry, Enno Poppe, Aribert Reimann, Steve Reich, Kaaja Saaraiaho, Rebecca Saunders, Karlheinz Stockhausen und Manos Tsangaris vorstellt und miteinander vergleicht.
Zum Seminar gehören ein gemeinsamer Besuch einer Aufführung von Abrahams The Snow Queen in der Dresdner Semperoper sowie ein Gespräch mit dem Komponisten. Termine: 31. Oktober, 7. November, 21. November, 19. Dezember jeweils 9.30-14.30 Uhr sowie 10. Dezember, 18.30-22.30 Uhr sowie 2.Oktober 18-21 Uhr. Voranmeldung ist erbeten. Vorbesprechung zum Ablauf in der ersten Sitzung am 2.10. um 18 Uhr.
-
Musikgeschichte 1730-1900
Do, 14:30 - 16:00Modul-CodesMg MuTh 2 (BA MU)
TuH 2 - D/K/MK (BA MU)
TuH 2 KJRP (BA MU)
TuH 2 Komp (BA MU)
TuH 2 (BA MU)RaumW 4.12
DozentDr. Wolfgang Mende
ZeitenDo, 14:30 - 16:00 Uhr
SemesterWS/SS
Pflicht fürBachelor Chordirigieren
Bachelor Gesang
Bachelor IGP Gesang
Bachelor IGP Klavier
Bachelor IGP Orchesterinstrumente/Blockflöte
Bachelor JRP Komposition
Bachelor Klavier
Bachelor Komposition
Bachelor Musiktheaterkorrepetition
Bachelor Musiktheorie
Bachelor Orchesterdirigieren
Bachelor OrchesterinstrumenteFachsemester3, 4
-
Musikgeschichte bis 1730
Mo, 12:00 - 13:30Modul-CodesTuH 1 (BA MU)
TuH 1 K/MK (BA MU)
TuH 1 KJRP (BA MU)
TuH 1 KJRP (BA MU)
TuH 1 Komp (BA MU)
TuH 1 Dir (BA MU)RaumW 4.07
DozentDr. Wolfgang Mende
ZeitenMo, 12:00 - 13:30 Uhr
SemesterWS/SS
Pflicht fürBachelor Chordirigieren
Bachelor Gesang
Bachelor IGP Gesang
Bachelor IGP Klavier
Bachelor IGP Orchesterinstrumente/Blockflöte
Bachelor JRP Komposition
Bachelor Klavier
Bachelor Komposition
Bachelor Musiktheaterkorrepetition
Bachelor Musiktheorie
Bachelor Orchesterdirigieren
Bachelor OrchesterinstrumenteFachsemester1, 2
-
Musikgeschichte des 20./21. Jahrhunderts
Mi, 15:30 - 17:00Modul-CodesMg MuTh 3 (BA MU)
TuH 3 KJRP (BA MU)
TuH 3 Komp (BA MU)
TuH 3 (BA MU)RaumW 4.12
DozentProf. Dr. phil. habil. Jörn Peter Hiekel
ZeitenMi, 15:30 - 17:00 Uhr
SemesterWS/SS
KommentarVom Beginn des 20. Jh bis zur Gegenwart reicht das zeitliche Spektrum der vorgestellten Kompositionen. Die Veranstaltung versucht, die faszinierende Vielfalt der koexistierenden kompositorischen Ansätze zu vermitteln. Die Veranstaltung ist offen für Studierende aller Fächer. Voranmeldung erbeten.
Beginn am 8. Oktober.Pflicht fürBachelor Chordirigieren
Bachelor Gesang
Bachelor IGP Gesang
Bachelor IGP Klavier
Bachelor IGP Orchesterinstrumente/Blockflöte
Bachelor JRP Komposition
Bachelor Klavier
Bachelor Komposition
Bachelor Musiktheaterkorrepetition
Bachelor Musiktheorie
Bachelor Orchesterdirigieren
Bachelor OrchesterinstrumenteFachsemester5, 6
-
Musikpraxis unter historischem Aspekt (Vorlesung)
Mo, 08:30 - 10:00Modul-CodesTuH 1 K/MK (BA MU)
TuP AM
TuH 1 (BA MU)RaumW 4.07
DozentProf. Bernhard Hentrich
ZeitenMo, 08:30 - 10:00 Uhr
SemesterWS/SS
Pflicht fürBachelor Chordirigieren
Bachelor Gesang
Bachelor IGP Gesang
Bachelor IGP Klavier
Bachelor IGP Orchesterinstrumente/Blockflöte
Bachelor Klavier
Bachelor Musiktheaterkorrepetition
Bachelor Orchesterdirigieren
Bachelor OrchesterinstrumenteFachsemester1, 2, 3, 4
Geschichte des Instituts
Der musikgeschichtliche Unterricht wurde in den Jahren nach der Hochschulgründung 1952 vom ersten Rektor Dr. Karl Laux und zahlreichen weitere Persönlichkeiten geprägt., u.a. von Dr. Herbert Meißner, Karl Hempel, Hans Böhm und Gottfried Schmiedel. In den 1970/80er Jahren gestalteten u.a. Dr. Frank-Harald Greß, Dr. Friedbert Streller, Dr. Gerd Schönfelder, Eberhard Kremtz, Dr. Hans John und die Lehrbeauftragten Dr. Dieter Härtwig und Eberhard Steindorf das Fach.
Seit 1977 besteht eine hochschuleigene Abteilung Musikwissenschaft, aus der im Jahre 1993 unter Einbeziehung des von Dr. Wolfram Steude gegründeten Heinrich-Schütz-Archivs das Institut für Musikwissenschaft hervorgegangen ist. Ihm gehörte als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Heinrich-Schütz-Archivs auch Dr. Manfred Fechner an. Dem langjährigen Institutsleiter Prof. Dr. Hans John folgte 2002 Prof. Dr. Manuel Gervink. Heute zählen zudem zum Institut für Musikwissenschaft die Professoren Dr. Michael Heinemann, Dr. Matthias Herrmann und Dr. Jörn-Peter Hiekel. Im Heinrich-Schütz-Archiv ist Konstanze Kremtz tätig.
Institut für Neue Musik
Das Institut für Musikwissenschaft legt besonderen Wert auf die Beschäftigung mit der zeitgenössischen Musik.
Zum Lehrprogramm gehört eine zweisemestrige Vorlesung "Neue Musik", zu den bevorzugt vergebenen Themen für Diplomarbeiten gehören solche aus der Musik des 20./21. Jahrhunderts. Darüber hinaus gibt es jedes Semester einige Veranstaltungen an der Schnittstelle von Theorie und Praxis. Das Institut arbeitet dabei eng mit den anderen Fachrichtungen zusammen, insbesondere mit dem Institut für Neue Musik.
Zu Gastvorträgen und Workshops kamen in den letzten Jahren u. a. Dieter Schnebel, Josef Anton Riedl, Vinko Globokar, Helmut Lachenmann, Nicolaus A. Huber, Luca Lombardi, Hans Werner Henze, Steffen Schleiermacher, Aribert Reimann, Georg Katzer, Adriana Hölszky, Peter Ruzicka, Georg Friedrich Haas und Vladimir Tarnopolski an die Dresdner Hochschule. In Kooperation mit dem Institut für Neue Musik gibt es außerdem jedes Jahr fünf auf das gesamte Studienjahr verteilte Workshops zu außereuropäischer Musik - mit Komponisten und Interpreten aus Asien, Afrika, Amerika oder Europa.
Konferenzen
Zwischen 1981 und 1993 war die damalige Musikwissenschaftliche Abteilung an zahlreichen internationalen Veranstaltungen im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele federführend beteiligt: Vier Konferenzen zur deutschen Romantik, sieben Konferenzen zur Dresdner Operngeschichte sowie Konferenzen zur Deutschen Oper in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zur Musikpflege der Dresdner Frauenkirche, zu Giacomo Meyerbeer, Felix Draeseke und Jan Dismas Zelenka. Darüber hinaus fanden in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen Symposien zu Heinrich Schütz, Carl Maria von Weber, Rudolf Mauersberger und zur Geschichte des Dresdner Kreuzchores statt. In der hauseigenen Schriftenreihe wurden die Konferenzberichte veröffentlicht; Ausnahmen bilden die Tagungsberichte zu Schütz bzw. zu Mauersberger und zum Kreuzchor, die beim Peters-Verlag Leipzig bzw. innerhalb der "Dresdner Hefte" erschienen sind.
Mit der Technischen Universität Dresden wurden darüber hinaus Konferenzen zur Romantik und zur Kunstreflexion über den 13. Februar 1945 veranstaltetet, desgleichen zur Frühromantik mit dem Dresdner Geschichtsverein e.V. und dem Kulturamt der Landeshauptstadt Dresden. Den alten Beziehungen zu Osteuropa Rechnung tragend, fand 1996 ein Kolloquium mit Musikologen des Konservatoriums St. Petersburg und des Instituts für Musikwissenschaft zu musikalischen Berührungspunkten zwischen Sachsen und Russland statt.
Einen Forschungsschwerpunkt hat das Institut in der Vielfalt der höfischen wie bürgerlichen Musik und -pflege der wettinischen Residenz- und Kunststadt Dresden gefunden. Zur Erkundung der vielfältigen Verbindungen Dresdens zur Musik der Gegenwart fanden gemeinsam mit dem Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik in den Jahren 1996, 1998 und 2000 vielbeachtete Tagungen unter dem Thema "Dresden und die avancierte Musik im 20. Jahrhundert" statt.
Im Oktober 2003 richtete die Hochschule eine große internationale Fachkonferenz zum Spätwerk von Dmitri Schostakowitsch aus. Im Mai 2004 folgte – in Kooperation mit den Dresdner Musikfestspielen – ein Kolloquium zum Thema "Märchenoper" sowie ein Symposium über Wilfried Krätzschmar. Im Oktober 2004 wurde in Kooperation mit dem Europäischen Zentrum der Künste Hellerau das Kolloquium "Kulturelle Identität(en)" veranstaltet, im November 2004 ein zweitägiges internationales Kolloquium über Bernd Alois Zimmermann. Im Juni 2005 befassten sich Tagungen mit „Musikalischen Wechselbeziehungen zwischen Sachsen und Böhmen in Vergangenheit und Gegenwart“ sowie der Musik von Adriana Hölszky, im November 2005 zum Thema „Hindemith und die Neue Musik der DDR“. Im Mai 2006 folgten ein Symposion zum Thema „Musik im mittelalterlichen Dresden“ im Rahmen des Stadtjubiläums „800 Jahre Dresden“ und der Dresdner Musikfestspiele, im Oktober 2006 über „Freiräume und Spannungsfelder. Zur Situation der zeitgenössischen Musik“ (in Kooperation mit dem Europäischen Zentrum der Künste Hellerau) sowie eine internationale Fachkonferenz zum Werk des Namensgebers der Hochschule, Carl Maria von Weber.
Im Jahr 2007 gab es Konferenzen zum Thema "Klanglandschaften. Musik und gestaltete Natur" (im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele) sowie zum Thema "Hören und Denken. Musik und Philosophie" (erneut in Kooperation mit dem Europäischen Zentrum der Künste Hellerau). 2008 wurden – häufig in unterschiedlichen Kooperationen – u.a. Konferenzen zu den Themen "Neue Musik und Film" sowie "1968 – aus musikalischer Perspektive", 2009 zu Bohuslav Martinů sowie "Perspektiven der Musik nach 1989" und 2010 anlässlich des 50. Todestages von Günter Raphael in Zusammenarbeit mit der Christine Raphael-Stiftung durchgeführt. 2011 fand zusammen mit der Internationalen Carl Maria von Weber-Gesellschaft das Internationale Symposion zum Thema "Carl Maria von Weber und das Virtuosentum seiner Zeit" statt. Das Institut für Musikwissenschaft war federführend an der Tagung „Johann Walter in Torgau und die evangelische Kirchenmusik“ auf Schloss Hartenfels (Torgau) beteiligt und spannte damit den Bogen zur Frühgeschichte der Sächsischen Staatskapelle Dresden.
Einen Höhepunkt stellt die Ausrichtung der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung im September 2013 dar. In mehreren Sektionen referierten Vertreter der deutschen Musikwissenschaft nicht nur in der Hochschule für Musik Dresden, sondern auch in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden sowie im Rohbau der ehemaligen evangelischen Schlosskapelle mit dem gerade fertig gestellten Schlingrippengewölbe (Residenzschloss Dresden). Bereits 2008 hatte an diesem musikgeschichtlich so bedeutsamen Ort eine Tagung in Verbindung mit dem Verein „Heinrich Schütz in Dresden“ e.V. und den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zur Musik in der Schlosskapelle der Schütz-Zeit stattgefunden.
Anlässlich des 91. Bachfestes der Neuen Bachgesellschaft (dem zweiten in Dresden seit 1968) richtete das Institut im September 2016 im Kleinen Saal eine Bach-Tagung aus, zudem im November d.J. ein Symposion anlässlich des 100. Todestages von Max Reger.
Weitere Konferenzen, die in vielfältigen Kooperationen ausgerichtet wurden:
- 2002: Ars magna musices. Athanasius Kircher 1602-2002. Rom, Deutsches Historisches Institut (in Zusammenarbeit mit Dr. Markus Engelhardt)
- 2003: Wolfgang-Stockmeier-Tage. Konzerte, Gottesdienste, Podiumsdiskussionen; in Zusammenarbeit mit Hochschule für Kirchenmusik Dresden (Prof. Dr. Christfried Brödel)
- 2004: Geld oder Leben. Richard Wagners „Ring“ (in Zusammenarbeit mit Semperoper Dresden, Prof. Dr. Ilsedore Reinsberg)
- 2004: Öffentliche Einsamkeit. Das Lied um 1900, Wien (in Zusammenarbeit mit Dr. Carmen Ottner und Prof. Dr. Hans-Joachim Hinrichsen)
- 2005 Max Reger. Orgelmusik im Kontext; öffentliches Seminar in Zusammenarbeit mit Sächsische Orgelakademie e.V. (Dr. Johannes Roßner)
- 2005 Am Rande des Abgrunds. 100 Jahre „Salome“ (in Zusammenarbeit mit Semperoper Dresden, Prof. Dr. Ilsedore Reinsberg)
- 2006: Musik im augustäischen Zeitalter (deutsch-polnische Arbeitstagung, in Zusammenarbeit mit TU Dresden, Prof. Dr. Hans-Günter Ottenberg, und SLUB Dresden, Dr. Karl-Wilhelm Geck)
- 2007: Das Faust-Recht auf Freiheit (in Zusammenarbeit mit Semperoper Dresden, Prof. Dr. Ilsedore Reinsberg, und Katholische Akademie Dresden, P. Clemens Maass SJ)
- 2008: Robert Schumann in Dresden (in Zusammenarbeit mit Musikwissenschaft TU Dresden, Prof. Dr. Hans-Günter Ottenberg)
- 2009: Oper mit Wissen- und Leidenschaft. Symposium anlässlich der Ehrenpromotion von Prof. Dr. h.c. Joachim Herz
- 2009: Diva – die göttliche Stimme (Projekttag Dresden, Juni 2009; in Zusammenarbeit mit P. Clemens Maass/Katholische Akademie Dresden, Ilsedore Reinsberg/Semperoper Dresden)
- 2009: Kulturgeschichte der Operette (mit André Meyer und Uwe Schneider, Staatsoperette Dresden)
- 2010: Weill-Interpretation (mit Dr. Joachim Lucchesi), Dresden
- 2011: „Operetten-Edition“ (mit Heiko Cullmann, Staatsoperette Dresden).
- 2013: Richard Wagner (in Zusammenarbeit mit TU Dresden, Prof. Dr. Hans-Günter Ottenberg, und Sächsische Akademie der Künste, Prof. Dr. Peter Gülke)
- 2013: „...was verloren ging“. Jüdische Traditionen in der Operette (mit Heiko Cullmann, Staatsoperette Dresden)
- 2013: „… wie es uns gefällt.“ Kurt Weill: The Firebrand of Florence (mit Heiko Cullmann, Staatsoperette Dresden)
- 2015: „Alles Schwindel“. Cagliostro in Wien; Symposium anlässlich der Johann-Strauss-Festtage der Staatsoperette Dresden (mit Heiko Cullmann)
- 2016: Kunst und Alltag – Der Briefwechsel von Clara und Robert Schumann (mit Thomas Synofzik, Schumann-Haus Zwickau)
Kontakt
Wolfgang Mende
Dr. Phil.
Leitung Institut für Musikwissenschaft
Prodekan Fakultät II
Vorsitzender der Promotionskommission
Vorsitzender der Abschlussarbeitskommission
Telefon: +49 351 4923-610
Raum P 4.06 (Wettiner Platz 10, 4. OG)
Sprechzeit: Montag, 16:30-17:30 (Voranmeldung per Mail erbeten)
Gerne auch per Videochat
In der vorlesungsfreien Zeit individuelle Terminabsprache per Mail
Konstanze Kremtz
Emeritierte Professoren

Manuel Gervink
Prof. Dr. phil. habil.
Musikwissenschaft (emeritiert)

Michael Heinemann
Prof. Dr. phil. habil.
Musikwissenschaft (emeritiert)

Matthias Herrmann
Prof. Dr. phil. habil.
Musikwissenschaft (emeritiert)