Dresdner Schriften zur Musik

Wilfried Krätzschmar und sein kompositorisches Werk. Texte von ihm und anderen Autoren
Matthias Herrmann (Hrsg.)
Tectum Verlag, Baden-Baden 2024
392 S., Bildteil, zahlreiche Notenbeispiele, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann, Bd. 5)
ISBN 978-3-68900-136-0
Das Werk von Wilfried Krätzschmar (*1944 in Dresden) umfasst avancierte Instrumental- und Vokalmusik und ist ein bleibendes Zeugnis der jüngeren deutschen Kulturgeschichte. Sowohl der Komponist als auch namhafte Autoren, darunter Peter Gülke, geben Einblicke in Krätzschmars Schaffen und sein kulturpolitisches Wirken seit den 1990er Jahren in der Landeshauptstadt Dresden und im Freistaat Sachsen. Es handelt sich um ein Kompendium des Schaffens von Wilfried Krätzschmar, der auch als Rektor der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden prägend gewirkt hat.
Mit Beiträgen von Christfried Brödel, Mattis Dänhardt, Frank Geißler, Peter Gülke, Matthias Herrmann, Jörn Peter Hiekel, Ekkehard Klemm, Wilfried Krätzschmar, Christoph Sramek, Michael Wüstefeld und Reiner Zimmermann.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de

Die mehrstimmigen Musikhandschriften des 15. bis 17. Jahrhunderts der Ratsschulbibliothek Zwickau
Gregor Hermann
Tectum Verlag, Baden-Baden 2023
258 S., mit Abbildungen, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann, Bd. 18)
ISBN 978-3-8288-4836-8
Die Musiksammlung der Ratsschulbibliothek Zwickau zählt zu den bedeutenden historischen Notensammlungen Mitteldeutschlands. Die vorliegende Studie bietet erstmals eine Gesamtschau auf die ca. 300 frühneuzeitlichen Musikhandschriften der Sammlung aus musikwissenschaftlicher wie bibliotheksgeschichtlicher Perspektive. Unter Einbeziehung zahlreicher bislang unbekannter Quellen widmet sich der Autor wichtigen Akteuren der mitteldeutschen Musikpflege des Reformationsjahrhunderts, die unter dem Einfluss von Humanismus und Polyhistorismus Maßgebliches zur Entstehung und zum spezifischen Charakter zahlreicher Handschriften beitrugen. Ein Katalog mit ausführlichen Beschreibungen aller Handschriften ergänzt den Band.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de

Die Dresdner und Berliner Sopranistin Elfriede Trötschel. Biografische und sängerische Aspekte
Suzana Bunarovska
Tectum Verlag, Baden-Baden 2023
348 S., Bildteil, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann, Bd. 17)
ISBN 978-3-8288-4813-9
Elfriede Trötschel (1913–1958) war eine Sopranistin aus Dresden. Der Anfang ihrer künstlerischen Laufbahn ist unmittelbar mit der Musikstadt Dresden verbunden, weitere Stationen waren Ost- und später Westberlin sowie eine Vielzahl internationaler Auftritte. Trötschels Viefältigkeit war beachtlich: von der Oper und vokal-sinfonischen Werken bis zur Kammermusik und Operette. Sie war bekannt für ihre Vorliebe für die Musik der Moderne sowie die Musik slawischer Komponisten.
Der vorliegende Band arbeitet neben einer Biografie Trötschels detailliert die Charakteristika der Stimme Trötschels aus und stellt ihre stimmtechnische, gesangliche und interpretatorische Diversität dar. Dabei werden 15 Darbietungen Trötschels intensiv analysiert.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de
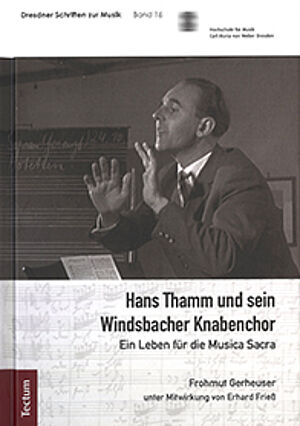
Hans Thamm und sein Windsbacher Knabenchor. Ein Leben für die Musica Sacra
Frohmut Gerheuser unter Mitwirkung von Erhard Frieß
Tectum Verlag, Baden-Baden 2022
317 S., mit zahlreichen Bildern, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann, Bd. 16)
ISBN 978-3-8288-4663-0
Der ehemalige Kruzianer Hans Thamm hat 1946 den Windsbacher Knabenchor gegründet und binnen weniger Jahre zu einem Spitzenchor geformt. Der Aufbau im kirchlichen Umfeld und in der kulturellen Abgeschiedenheit Windsbachs stieß immer wieder auf Unverständnis und Widerstände. Die vorliegende Biographie, zu Hans Thamms 100. Geburtstag geschrieben, gibt erstmals einen fundierten Überblick über seine Herkunft, Prägung und vor allem seine Leistungen als Chorleiter, visionärer Pionier-Unternehmer, engagierter Pädagoge und als gläubiger Verkünder der Musica Sacra, bis zu seinem vorzeitigen Ausscheiden 1977. Seine Kräfte waren aufgebraucht. Er blieb der Musica Sacra treu und hatte endlich Zeit für sich, seine Familie und seine Orgel.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de

Die Konzerttätigkeit der Königlichen Musikalischen Kapelle zu Dresden (1858–1918)
Eberhard Steindorf
Tectum Verlag, Baden-Baden 2022
2 Teilbände
1173 S., gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann, Bd. 14)
ISBN 978-3-8288-4626-5
Im 19. Jahrhundert entstand neben den Verpflichtungen bei Hofe, in Kirche, Oper und Theater ein neuer Schwerpunkt im Wirken der „Königlichen musikalischen Kapelle“ zu Dresden: das öffentliche Konzert. Nach einer Darstellung des Beginns dieser Entwicklung zwischen 1817 und 1958 in Teil I (Steindorf 2018, Tectum Verlag) dokumentiert Teil II nunmehr die Konzerttätigkeit des Orchesters während der nachfolgenden Jahrzehnte bis 1918. Einen Schwerpunkt bilden dabei die 1958 auf Eigeninitiative der Musiker begründeten Abonnementskonzerte, um die sich eine Vielzahl weiterer Konzertveranstaltungen gruppierte, vom Pult aus vorrangig durch Dirigenten wie Julius Rietz, Franz Wüllner, Ernst von Schuch und Fritz Reiner geprägt.
In zwei Teilbände gefasst bietet Teil II einen Einblick in Hunderte von Programmen und Mitwirkenden sowie umfangreiches Presse- und Archivmaterial, etwa im Hinblick auf Aspekte des Musizierens und der Orchesterspezifika, Dirigenten- und Musikerprofile, des Repertoires und der Programmgestaltung, der Publikumsresonanz, der Säle oder auch auf Vorgänge in Administration und Orchesterpraxis.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de

Lothar Voigtländer und sein kompositorisches Werk. Texte von ihm und anderen Autoren
Matthias Herrmann (Hrsg.)
Tectum Verlag, Baden-Baden 2023
290 S., Bildteil, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann, Bd. 13)
ISBN 978-3-8288-4442-1
Der namhafte deutsche Komponist Lothar Voigtländer (*1943 in Leisnig/Sachsen) sammelte erste musikalische Erfahrungen im Dresdner Kreuzchor unter Rudolf Mauersberger. Nach dem Studium an der Leipziger Hochschule für Musik und der Kapellmeister-Tätigkeit war er Meisterschüler Günter Kochans an der Akademie der Künste der DDR in Berlin, wo er seit 1973 lebt. 2001–2008 wirkte Voigtländer als Profssor für Komposition an der Musikhochschule in Dresden.
Sein Œuvre mit szenischen Werken, Sinfonik, Oratorien, Kammer- und Chormusik sowie Liedern beinhaltet seit den 1970er-Jahren auch elektro-akustische Musik, die Voigtländer auch in Frankreich bekannt gemacht hat.
Der Band versammelt Texte des Komponisten sowie der Autoren Matthias Herrmann, Ekkehard Klemm, Ulrike Liedtke, Albrecht von Massow u.a. zum Gesamtwerk. Archiviert ist der kompositorische Vorlass Voigtländers in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de
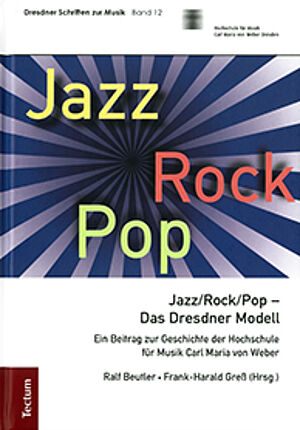
Jazz/Rock/Pop – Das Dresdner Modell. Ein Beitrag zur Geschichte der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber
Ralf Beuter, Frank-Harald Greß (Hrsg.)
Tectum Verlag, Baden-Baden 2021
152 S., mit zahlreichen Abbildungen, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann, Bd. 12)
ISBN 978-3-8288- 4441-4
Dresden 1962: Noch herrschte Argwohn gegenüber der „amerikanischen“ Musik in der DDR-Kulturpolitik. Trotzdem gelang es, an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden eine Ausbildung für Jazz zu gründen, zunächst getarnt als „Tanz- und Unterhaltungsmusik“. Die Aufbauerbeit strahlte aus, differnezierte und erweiterte sich auf Rock un Pop. Sie bereicherte das Musikleben durch vielfältige Veranstaltungen. Ferienkurse und pädagogisch befähigte Absolventen wirkten in die Breite.
Mit tiefgreifenden Veränderungen durch die politische Wende entfaltete sich die internationale Anziehungskraft der Dresdner Jazz/Rock/Pop-Ausbildung und führte zur Mitarbeit erfolgreicher Künstler und Pädagogen sowie zum Zustrom von Studienbewerbern aus vielen Ländern. Identität und Teamgeist blieben erhalten.
Die Viefalt der Arbeit zeigen die Bereiche Bachelor-, Master- und Graduiertenstudium, Musikpädagogik, Lehramt Musik, Kinderklasse sowie die Zusammenarbeit mit dem Landesgymnasium für Musik Dresden.
Kurzum: Das „Dresdner Modell“ hat sich bewährt und verspricht auch künftigen Erfolg.
In 25 Essays berichten gegenwärtig Lehrende und Absolventen über ihre Arbeit, ihre Erfahrungen, individuellen Sichten und die Wechselwirkung zwischen künstlerischer Praxis und pädagogischer Tätigkeit. Der reich illustrierte Band vermittelt einmalige Einblicke in die Struktur und die Ziele dieses Studienbereichs.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de

Der Komponist Manfred Weiss. Texte von ihm und anderen Autoren
Matthias Herrmann (Hrsg.)
Tectum Verlag, Baden-Baden 2023
277 S., Bildteil, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann, Bd. 9)
ISBN 978-3-8288-3883-3
Manfred Weiss, geboren 1935 in Niesky, gehört zu den namhaften Komponisten Sachsen. 1959–1999 lehrte er in Dresden an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber. Wilfried Krätzschmar und Jörg Herchet zählten zu seinen Komponistenkollegen.
Das Œuvre mit Sinfonien, Konzerten, Kammermusik und Vokalwerken, auch auf geistliche Texte, kam durch nahmhafte Klangkörper zur Aufführung: Dresdner Kreuzchor, Dresdner Philharmonie, Gewandhausorchester Leipzig, Sächsische Staatskapelle u. v. a.
Der Band vereint Texte des Komponisten und anderer Autoren, darunter Kollegen und Schüler. Der Herausgeber Matthias Herrmann schätzt Weiss‘ Musik seit Langem. Das Geleitwort schrieb Christfried Brödel, früherer Rektor der Dresdner Hochschule für Kirchenmusik.
Mit Beiträgen von Christfried Brödel, Gottfried Glöckner, Wolfgang Heisig, Jörg Herchet, Matthias Herrmann, Alfred Holzhausen, Ekkehard Klemm, Jürgen Knauer, Wilfried Krätzschmar, Axel Langmann, Raier Lischka, Christian Münch und Manfred Weiss sowie mit zahlreichen Kommentaren zu Weiss-Werken aller Genres aus dem Privatarchiv des Komponisten.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de

Sichten auf Max Reger und seinen Schüler Paul Aron. Mit Korrespondenz des Ehepaars Reger und Aron
Matthias Herrmann (Hrsg.)
Tectum Verlag, Baden-Baden 2020
196 S., Bildteil, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann, Bd. 8)
ISBN 978-3-8288-4300-4
Das Œuvre von Max Reger (1873–1916) rief zu Lebzeiten des Komponisten Zustimmng und Ablehnung hervor. Auch als Person vermochte Reger zu polarisieren.
Dieser Band befasst sich mit Regers kompositorischem Werk und mit seinem persönlichen Umfeld – in Gestalt des aus Dresden stammenden Schülers Paul Aron (1886–1955). dieser gehörte zeitweise zum näheren Beziehungsgeflecht des Ehepaars Reger. Die hier erstmals vollständig edierten Reger-Briefe und –Karten an Aron der Jahre 1905–1915 sowie Beurteilungen Regers werden ergänzt durch Aron-Briefe von der Front des Ersten Weltkrieges an Elsa Reger nach dem Tod ihres Mannes (1916–1918).
Zu den hier vorgelegten Texten der Professoren des Instituts für Musikwissenschaft der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden Manuel Gervink, Michael Heinemann, Matthias Herrmann und Jörn Peter Hiekel kommen weitere hinzu von Peter Gülke (Inhaber des ersten verliehenen Ehrendoktorats der genannten Hochschule) sowie von Stefanie Steiner-Grage und Vitus Froesch, die seinerzeit in Dresden im Fach Musikwissenschaft promoviert wurden.
Nach der biografischen Einführung geht es um Regers Orchestervariationen, seine Kammer- und Orgelmusik, seine Rolle als Lehrer und Professor für Komposition sowie seine Wirkung auf die Neue Musik seiner Zeit bis zur Gegenwart.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de

Überdada, Componist und Expressionist. Erwin Schulhoff in Dresden. Mit Briefen, Dokumenten und seinem Tagebuch
Matthias Herrmann (Hrsg.)
Tectum Verlag, Baden-Baden 2023
400 S., Bildteil, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann, Bd. 15)
ISBN 978-3-8288-4616-6
Der Prager Musiker Erwin Schulhoff (1894-1942) wirkte nach Kriegsende 1919/20 in Dresden, veranstaltete Fortschrittskonzerte und korrespondierte mit Schönberg und Grosz. Anregungen des Expressionismus, Dadaismus und Jazz finden sich in seinem Werk.
Die Texte, die von einem unangepassten Menschen zeugen, werden durch einen Abbildungsteil mit Fotos aus dem Prager Nachlass, Zeugnissen aus dem Leipziger Studium, Dada-Dokumenten aus Wien und Belegen seiner Affinität zur innovativen Kunstszene Dresdens ergänzt. Der Erstdruck des kommentierten Tagebuchs trägt zur biografischen Kenntnis Schulhoffs bei, den die deutsche Besatzungsmacht 1941 in Prag inhaftierte. Er starb im Internierungslager für Sowjetbürger auf der Wülzburg (Bayern) an Tuberkulose.
Mit Beiträgen von Manuel Gervink, Michael Heinemann, Matthias Herrmann, Jörn Peter Hiekel, Tobias Schick, Johannes Schmidt, Miriam Weiss und Tobias Widmaier.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de
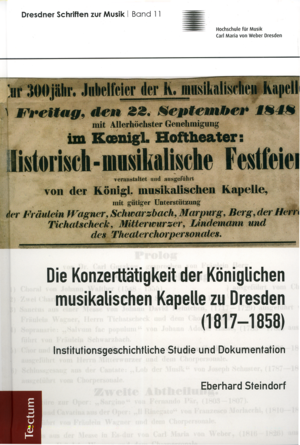
Die Konzerttätigkeit der Königlichen musikalischen Kapelle zu Dresden (1817–1858). Institutsgeschichtliche Studie und Dokumentation
Eberhard Steindorf
Tectum Verlag, Baden-Baden 2018
960 S., gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann; Bd. 11)
ISBN 978-3-8288-4155-0
mehr zum Inhalt
Der Sächsischen Staatskapelle Dresden wird als Opern- wie als Konzertorchester hohe internationale Anerkennung gezollt. Während die 1548 gegründete kurfürstliche Hofkapelle seit dem 17. Jahrhundert der Bühne verpflichtet war, bildete sie als Königliche musikalische Kapelle ihre Qualitäten auf dem Konzertpodium in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kontinuierlich und in erstaunlichem Umfang aus – eine Entwicklung, die bisher weitgehend unerforscht geblieben ist. Die vorgelegte Dokumentation gibt, vorwiegend anhand von Presse- und Archivmaterial, einen Überblick über Daten, Programme, Interpreten, Konzertformen, Säle, Veranstalter, interne und äußere Vorgänge, künstlerische Leistungen und Bedingungen, kritische Wertungen und Publikumsresonanz in den Jahren zwischen 1817 und 1858, als die Kapellmeister Morlacchi, Weber, Wagner und Reißiger an der Spitze des Orchesters standen. Eine vorangestellte Studie weist auf die Tradition der Kapelle und das institutionelle und künstlerische Gefüge hin, in dem sich ihre Konzertaktivitäten vollzogen.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de
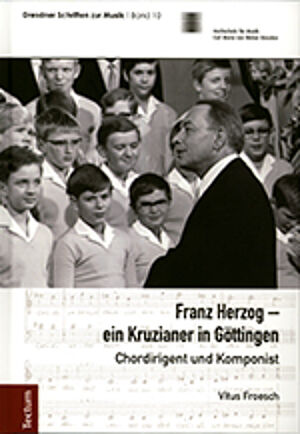
Franz Herzog – ein Kruzianer in Göttingen. Chordirigent und Komponist
Vitus Froesch
Tectum Verlag, Marburg 2017
176 S., mit zahlreichen Bildern, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann; Bd. 10)
ISBN 978-3-8288-3954-0
mehr zum Inhalt
Über Jahrzehnte hat Franz Herzog (1917-1986) das Musikleben Göttingens mit geprägt. Aus einem Schulchor, den er als Musiklehrer am Felix-Klein-Gymnasium 1953 aufbaute, bildete er den noch heute bestehenden Göttinger Knabenchor. Diesem Ensemble prägte er einen strahlenden und expressiven Klangcharakter auf. Daneben war Herzog ein vielseitiger und anspruchsvoller Komponist und hinterließ rund 200 Werke.
Seine Fähigkeiten kamen nicht von ungefähr, hatte er doch seine Gymnasialzeit im Dresdner Kreuzchor verbracht. Dort wurde sein hohes musikalisches Talent von Kreuzkantor Rudolf Mauersberger gefördert, sodass er diesen noch als Kruzianer bei Einstudierungen und Aufführungen vertrat. Musik studierte Herzog am Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden, der heutigen Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden.
Mit diesem Band liegt nun die erste Monographie zu Franz Herzog und seiner Lebensleistung vor. Seltene Fotografien sowie Verzeichnisse seiner Werke und der nachweisbaren Tonaufzeichnungen runden den Band ab.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de
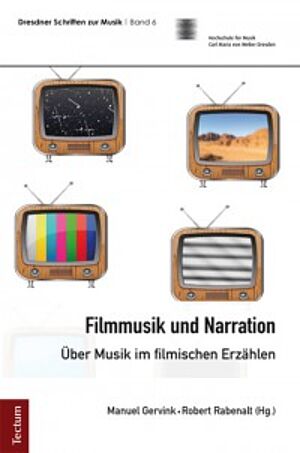
Filmmusik und Narration. Über Musik im filmischen Erzählen
Manuel Gervink und Robert Rabenalt (Hrsg.)
Tectum Verlag, Marburg 2017
253 S., gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann; Bd. 6)
ISBN 978-3-8288-3682-2
mehr zum Inhalt
Die ausgesuchten Beiträge beschäftigen sich mit der Frage, wie filmisches Erzählen durch Musik beeinflusst wird. Hierbei zeigt die Vielfalt der Perspektiven künstlerische Möglichkeiten genauso wie analytische Methoden und Terminologie auf. Mit vielen Beispielen aus unterschiedlichen Genres, Erzählformen und Entstehungszeiten werden individuelle aber auch generelle Vorgehensweisen erklärt und konkrete Zugänge zur Thematik offeriert.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de
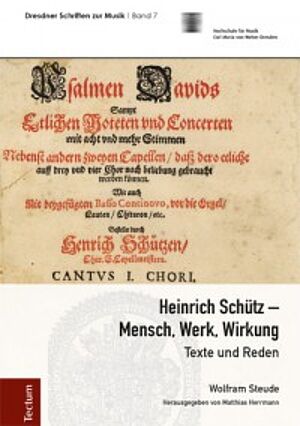
Heinrich Schütz – Mensch, Werk, Wirkung Texte und Reden
Wolfram Steude
Tectum Verlag, Marburg 2016
356 S., mit Abbildungen, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann; Bd. 7)
ISBN 978-3-8288-3840-6
mehr zum Inhalt
Der renommierte Dresdner Musikwissenschaftler Wolfram Steude hat sich seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts intensiv mit dem kursächsischen Hofkapellmeister Heinrich Schütz (1585–1672) auseinandergesetzt. 1985 schrieb er:
"Schütz war weder 'Kirchenmusiker' im eingeschränkten Sinne von heute, noch war er 'weltlicher Kapellmeister' im heutigen Sprachgebrauch – er war als Hofkapellmeister beides."
In knapp vier Jahrzehnten entfaltete Wolfram Steude ein komplexes Forschungsprogramm zu Schütz. Er befasste sich ausgiebig mit Biographie und Umfeld des Komponisten, mit dem Wirken an Fürstenhöfen und in Kirchen sowie mit Aspekten des Gesamtwerks, seiner Überlieferung und Nachwirkung bis in die Gegenwart.
Im vorliegenden Band sind 23 Texte und Reden zum Thema Heinrich Schütz versammelt. Sie entstanden für Buch, Jahrbuch, Zeitschrift und Tageszeitung bzw. als Redemanuskript und Rundfunkbeitrag. Aus der Gesamtschau ergibt sich ein beeindruckendes, facettenreiches Bild eines Menschen und Musikers von europäischer Ausstrahlung.
Wolfram Steude (geb. 1931 in Plauen/Vogtland) studierte Kirchenmusik, Musik- und Kunstgeschichte vor allem in Leipzig. Danach wirkte er zeitlebens in Dresden: als evangelischer Kantor (bis 1976), als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Sächsischen Landesbibliothek (1961–1980) sowie als Kustos und Professor für Alte Musik an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber (1980–1996). Er war leitendes Mitglied der Cappella Sagittariana, einem Dresdner Ensemble für Alte Musik, und Mitherausgeber des Schütz-Jahrbuchs der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft, Kassel. Kurz vor seinem Tode 2006 gründete er den Verein "Heinrich Schütz in Dresden".
Bezug über:
www.tectum-verlag.de
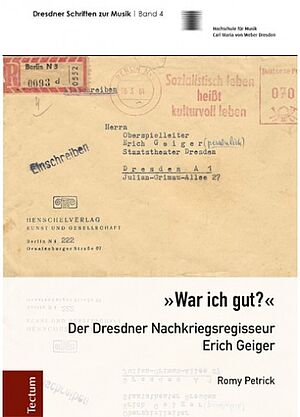
"War ich gut?" Der Dresdner Nachkriegsregisseur Erich Geiger
Romy Petrick
Tectum Verlag, Marburg 2015
311 S., mit zahlreichen Notenbeispielen, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann; Bd. 4)
ISBN 978-3-8288-3660-0
mehr zum Inhalt
Der Regisseur und Bühnenautor Erich Geiger (1924–2008) ist heute weitgehend unbekannt, obwohl er mit seinen innovativen Inszenierungsideen in den 1950er Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann er in Karlsruhe und Berlin eine fulminante Theaterkarriere, die ihn schließlich an die Staatsoper Dresden führte. Dort prägte er ein Jahrzehnt als Oberspielleiter die Entwicklung der Oper maßgeblich mit. Seine Inszenierungen zeichneten sich durch experimentelle Ansätze und außergewöhnliche Beleuchtungseffekte aus, die von seiner Arbeit beim Fernsehen beeinflusst wurden.
Zwischen den beiden deutschen Staaten pendelnd, bezog er nur selten offen Stellung zu politischen Fragen. Trotzdem wurde er in der DDR zum unbequemen Außenseiter. 1965 verließ Geiger die DDR, da er sich dort künstlerisch nicht weiter entfalten konnte.
Anhand seiner Inszenierungen zeichnet die Musikwissenschaftlerin und Sängerin Romy Petrick den künstlerischen Werdegang dieses vergessenen Regiesseurs nach und beleuchtet damit ein packendes Stück Theatergeschichte.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de
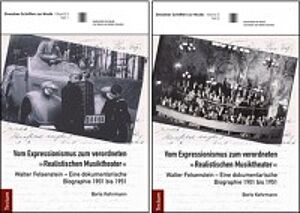
Vom Expressionismus zum verordneten "Realistischen Musiktheater" Walter Felsenstein – Eine dokumentarische Biographie 1901 bis 1951
Boris Kehrmann
Tectum Verlag, Marburg 2015
2 Teilbände
1362 S., gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann; Bd. 3)
ISBN 978-3-8288-3266-4
mehr zum Inhalt
Bis heute wird Walter Felsenstein (1901–1975) automatisch mit dem Attribut des „Realistischen Musiktheaters“ belegt. Dabei hielt der Regisseur „Realismus“ für das Unkünstlerische schlechthin. Erst als der Ostberliner Magistrat drohte, der Komischen Oper die Subventionen zu entziehen, nahm er die Vereinnahmung seines Schaffens für den (Sozialistischen) Realismus widerstrebend hin. Andernfalls hätte es das Aus für seinen seit 1932 gehegten Lebenstraum einer Reformoper bedeutet. Unter diesem, ihm im Zeichen des „Kalten Krieges“ aufgezwungenen „Kompromiss“ hat er, der seit 1918 Theater machte, gelitten. Der innere und äußere Kampf gegen Bürokraten und Ideologen zermürbte ihn. Und doch ist es ausschließlich der „alte Felsenstein“, der heute das Felsenstein-Bild prägt.
Die dokumentarische Biographie unternimmt es erstmals, den Fokus auf die ersten 50 Lebensjahre des bahnbrechenden Theatermannes zu richten. Sie lässt nachträglich verfälschende Erinnerungen beiseite und stützt sich kritisch auf zeitgenössische Quellen aus zahlreichen öffentlichen und privaten Archiven in vier Ländern. Hauptquelle sind die hier erstmals veröffentlichten Briefe an seine erste Frau Ellen Neumann sowie wesentliche Familienbriefe, die uns im innerfamiliären Dialog über Systemgrenzen hinweg erschließen, was Felsenstein jenseits diplomatischer und politischer Taktik dachte.
Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der bisher unerforschten Zeit von 1901 bis 1951. Die letzten 24, äußerlich glanzvollen, innerlich von zunehmender Isolation geprägten Lebensjahre werden schlaglichtartig beleuchtet, sofern sie die Themen dieses Buches spiegeln: Die Kontinuität seines durch Expressionismus, Ersten Weltkrieg und die Revolutionen von 1917ff. geprägten Schaffens und die Bewältigung der eigenen Vergangenheit.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de
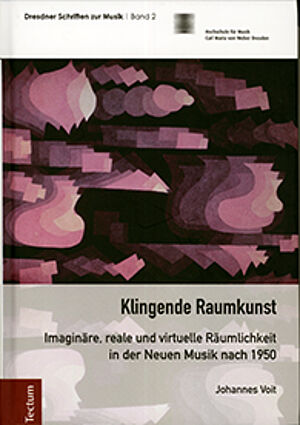
Klingende Raumkunst Imaginäre, reale und virtuelle Räumlichkeit in der Neuen Musik nach 1950
Johannes Voit
Tectum Verlag, Marburg 2014
333 S., mit zahlreichen Abbildungen, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik hrsg., von Matthias Herrmann; Bd. 2)
ISBN 978-3-8288-3261-9
mehr zum Inhalt
Musik entfaltet sich in der Zeit, aber hat sie auch eine räumliche Ausdehnung? Spätestens seit Lessings einflussreicher Schrift Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie galt die Musik vornehmlich als Zeitkunst, im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich dies jedoch grundlegend geändert. Seit Komponisten zunehmend räumliche Aspekte in ihre Kompositionen einbeziehen, das starre Gegenüber von Podium und Publikum hinterfragen und mit intermediären Werken aus den Bereichen Klangskulptur, Klanginstallation oder Klangperformance die Grenzen zwischen Musik und Bildender Kunst aufzulösen beginnen, hat sich auch die Art verändert, wie wir über Musik sprechen.
Johannes Voit liefert eine sorgsame Systematisierung der verschiedenen räumlichen Aspekte, die speziell in der Neuen Musik und der Klangkunst eine Rolle spielen, und veranschaulicht diese an ausgewählten Beispielen. Zahlreiche Bezüge zur Bildenden Kunst geben Einblicke in die wechselseitige Beeinflussung der beiden Künste und beleuchten die philosophische und wahrnehmungspsychologische Komponente der stets neu zu stellenden Frage nach dem Verhältnis von Zeit und Raum in den Künsten.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de
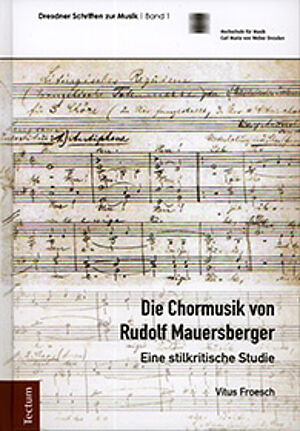
Die Chormusik von Rudolf Mauersberger. Eine stilkritische Studie
Vitus Froesch
Tectum Verlag, Marburg 2013
220 S., mit zahlreichen Notenbeispielen, gebunden
(Dresdner Schriften zur Musik, hrsg. von Matthias Herrmann; Bd. 1)
ISBN 978-3-8288-3064-6
mehr zum Inhalt
Eine umfassende stilkritische Studie über den Komponisten Rudolf Mauersberger (1889–1971). Seine Chormusik gewinnt zunehmend an Bedeutung und kommt außerhalb Dresdens häufiger denn je zur Aufführung. Für den Dresdner Kreuzchor entstandene Werke wie die Motette „Wie liegt die Stadt so wüst“ und das „Dresdner Requiem“ sind inzwischen in das Repertoire zahlreicher Chöre eingegangen. Anhand von Notenbeispielen wird die zentrale Bedeutungsebene im Chorwerk des ehemaligen Kreuzkantors – das Verhältnis von Text und Musik – spannend entschlüsselt.
Bezug über:
www.tectum-verlag.de